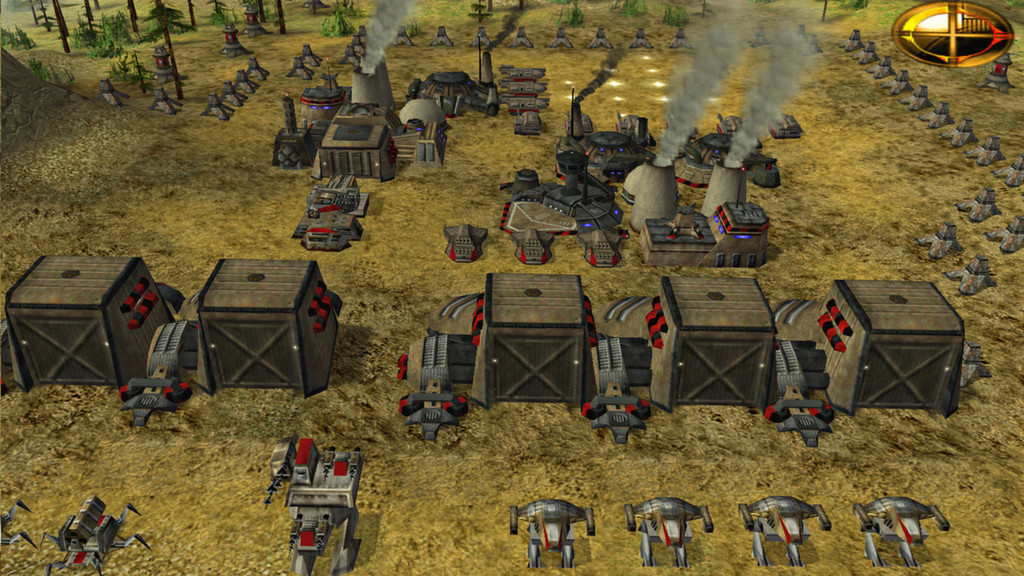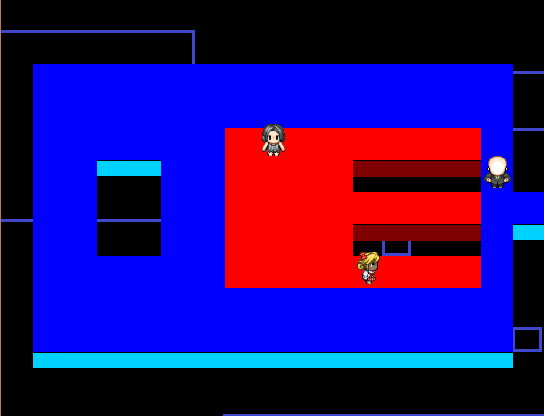14.07.1888
Vor drei Wochen brach jeglicher Kontakt zum Dorf Grünwick ab. Eine Militärexpedition scheiterte. Eine vom kaiserlichen Hof einberufene Kommission begann anschließend mit der Befragung von Zeugen und anderen relevanten Personen. Dies sind unvollständige Ausschnitte aus diesen Befragungen, zusammengetragen aus den Beständen mehrerer Archive […]
Viktor Schleier (56), Kaufmann
Ich will zu Beginn anmerken, dass ich seit 30 Jahren nicht mehr in Grünwick lebe und nur sporadisch entfernte Verwandte dort besucht habe. Ich war eigentlich immer gerne da. Ein guter Ausgleich zu der Hektik in München. Es leben wohl nicht mehr als 200 Menschen im Dorf und der nahen Umgebung. Liegt tief im Wald und es führt eigentlich nur ein richtiger Pfad dorthin, der im Winter häufig unpassierbar ist. Die meisten Einwohner sind Selbstversorger und nach außen wird eigentlich nur Holz, Wildfleisch und Felle verkauft. Die Mehrzahl der Menschen dort weiß nicht was eine Dampfmaschine genau ist und halten Elektrizität für Magie. Einfaches Volk, aber dafür auch herrlich unkompliziert und wenn man sich etwas zur Natur zurückbesinnen will, ist Grünwick der ideale Ort. Was eine Ursache für den Kontaktabbruch sein könnte? Schwierig. Ich glaube ehrlich gesagt an keine Naturkatastrophe. Es gibt dort weder Flüsse, die überlaufen, noch Hänge, die abrutschen könnten. Einen Waldbrand hätte man wohl vom nächsten Nachbardorf sehen können. Mir fällt nur eine Sache ein. Ich kann nicht sagen, ob es wirklich etwas mit dem Kontaktabbruch zu tun hat, doch ich habe bei meinen Besuchen einige Ungereimtheiten im Dorf mitbekommen. Holzhändler dieser Region können sicher bestätigen, dass Grünwick in den letzten Jahren seine Ausfuhr fast verdreifacht hat. Und nicht nur das! Das Holz besaß eine wesentlich bessere Qualität als sonst. Es ist nun nicht so, dass es plötzlich eine neue Sägemühle oder einen neuen Schwung neuer Arbeiter gab. Nein. Soweit ich es mitbekam, war die Ursache dafür ein einzelner Holzfäller. Ein Zugezogener nach Grünwick. Ich habe den jungen Mann nie kennengelernt, da er abseits des Dorfes in einer Waldhütte lebte. Doch er arbeitete, wie ich hörte, unermüdlich wie ein Ochse und verstand sich hervorragend mit den Kindern. Hektor war sein Name. Die Leute hielten sich von ihm fern und es gab mehrere unschöne Gerüchte über ihn. Zuerst glaubte ich, dass man ihn nicht mochte, weil er ein Außenseiter war. Doch irgendwann begriff ich, dass man ihn regelrecht fürchtete. Da war mehr als nur der natürliche Misstrauen einer kleinen Dorfgemeinschaft. Leider habe ich nie genau nachgefragt, da ich an meinen freien Tagen in Grünwick besseres zu tun hatte, als einem Holzfäller hinterher zu schnüffeln. Mehr kann ich also leider für den Moment nicht sagen. Aber ich kenne jemanden, der noch bis vor kurzem in Grünwick lebte. Diese Person kann eventuell mehr erzählen. Ich versuche mal Kontakt herzustellen […]
Roland Bauer (43), Holzhändler
Schon mein Vater hat Holz aus Grünwick gekauft, lange bevor die industrielle Sägemühle in Kollraab gebaut wurde. Es war ordentliches Holz und es gab nie Gründe, um sich zu beschweren. Doch die Stämme, die in den letzten Jahren zu mir kamen, waren anders. Es gibt eigentlich immer kleinere Anzeichen von Holzkäfern, Vögeln oder anderen Ungeziefer. Manchmal müssen deswegen sogar einzelne Stämme aussortiert werden. Doch seitdem dieser Hektor dort Bäume fällt, so finde ich gar keine Schäden mehr am Holz. Keine Beschädigungen oder sogar Verformungen. Die Stämme sind beinahe perfekt rund, fester und weniger brüchiger. Sie werden mir als Kiefern verkauft, doch ich zweifelte immer wieder an, ob dies wirklich stimmte. Es wirkte nicht wie Kiefernholz. Wissen Sie, durch meine Hände ist schon allerhand gegangen. Ich kenne die Ringe von jeder europäischen Baumart. Ich verkaufte sogar Tropenhölzer und asiatischen Bambus. Ich kenne mich aus. Doch ich konnte teilweise nicht mehr sagen, was da genau aus Grünwick zu mir kam. Ich verkaufte es als Kiefer weiter, weil ich selbst nicht wusste, als was ich es sonst ausschildern soll. Einmal habe ich sogar einen meiner Assistenten in das Dorf geschickt, um persönlich anwesend zu, wenn der Hektor eine Kiefer fällte. Das Holz hatte dieselbe merkwürdige Qualität wie sonst, also versuchte der Kerl mir nicht irgendeine andere Baumart als Kiefer anzudrehen. Er hätte ehrlich auch keinen Grund dazu gehabt. Auch stimmte etwas mit dem Wachstum der Bäume nicht. Bei der schieren Menge, die Hektor jedes Jahr fällte, sollte der Wald um Grünwick eigentlich langsam freigerodet werden. Doch stattdessen wurde der Wald dichter! Ich schwöre beim Herrn und beim Namen des Kaisers, dass mein Assistent bei jedem Besuch im Dorf mehr Jungbäume beim Wegesrand sah […]
Joseph Gschwend (51), ehemaliger Einwohner von Grünwick
Ja, wie bereits aus dem Briefverkehr entnommen, komme ich aus Grünwick und bin vor drei Jahren ausgezogen. Ich bin auch ein alter Freund von Viktor Schleier, der mich kürzlich kontaktiert hat. Ich habe ehrlich gesagt beinahe das Dorf gänzlich aus meinem Gedächtnis verbannt, zumal mich sowieso keine familiären Bande mehr dahin verbinden. Deswegen kann ich wenig zu aktuellen Geschehnissen sagen. Da Sie aber schon von dem Holzfäller Hektor gehört haben, so kann ich von seiner Ankunft im Dorf berichten. Ob er etwas mit dem Kontaktabbruch zu tun hat, weiß ich nicht. Zumindest fand man ihn als kleinen Jungen nackt im Wald. Es war ein besonders kalter Herbsttag, doch er zeigte keine Anzeichen von Unterkühlung. Deswegen nahmen wir an, dass er erst kürzlich ausgesetzt wurde. Sein einziger Besitz war eine Kette um seinen Hals, an der kleine Tierknochen und Holzstücke befestigt waren. In diesen hatte irgendwer Zeichen geschnitzt, die keiner von uns entziffern konnte. Manche dachten es wäre russisch und andere arabisch. Die alte Müllerwitwe hielt es dagegen für dämonische Symbole. Der junge Hektor konnte anscheinend unsere Sprache nicht verstehen und redete selbst kein Wort. Er blieb bis zu meinem Verlassen des Dorfes stumm.
Der Junge lebte zuerst bei einer älteren und blinden Frau, die jede Hilfe im Haushalt brauchte. Er war ihr zu Diensten, bis sie vier Jahre später verstarb. In dieser Zeit lernte er Deutsch zu verstehen und zog aus ihrem Haus aus, um im Wald als Holzfäller zu arbeiten. Ich muss anmerken, dass er trotz seines hohen Körperbaus keine dreizehn Jahre alt sein konnte zu dem Zeitpunkt. Trotzdem zeigte er sofort großen Eifer in seinem gewählten Beruf und schien ein Naturtalent. Ohne einen Lehrmeister schnitt und fällte er die Bäume nicht nur präzise, sondern auch in hoher Zahl. Auf seinen Schultern trug er dann die Stämme zum Dorf. Seine Kraft war wahrlich außergewöhnlich. Nach einem Jahr begann er sich ein eigenes Haus im Wald zu bauen und nachdem der alte Peter die Axt niederlegte, war er der einzig verbliebene Holzfäller in Grünwick.
Sein Verhältnis zu den restlichen Bewohnern war immer angespannt. Niemand war jemals vorgekommen und hatte sich als seine Familie vorgestellt. Er selbst schien kein Interesse daran zu haben zu wissen, woher er stammte. Stattdessen ging er jeden Morgen bei Sonnenaufgang in den Wald und man hörte bis zum Abend das Schlagen seiner Axt. Trotz seiner offensichtlichen Tüchtigkeit blieben die Menschen weiterhin misstrauisch ihm gegenüber. Die Umstände seiner rätselhaften Ankunft blieben allen weiterhin im Gedächtnis. Weiterhin machte er nie Anstalten sich im Rest der Gemeinschaft zu integrieren und verblieb in seiner Waldhütte. Die kleine, lokale Kneipe hat er, soweit ich weiß, niemals betreten.
Gleichzeitig war seine ständige Arbeit auch eine wichtige Geldquelle für Grünwick. Er hortete nichts und kaufte immer lokal, sodass sein wachsendes Vermögen nicht irgendwie in Nachbardörfern versickerte.
Bald war er sogar beinahe schon die einzige Geldquelle im Dorf. Die Kräutersammler und Jäger gingen immer seltener in den Wald und wenn, dann fanden sie weniger Beute. Nach und nach legten sie alle die Arbeit nieder.
Vor drei Jahren kam dann Hermann Ilckgrund, der letzte Jäger im Dorf, mit einem bleichen Gesicht zu mir und meinte, wir müssten beide sofort Grünwick verlassen. Er nannte keine Gründe. Er betonte nur immer wieder, dass wir gehen müssten. Dies verwirrte mich zwar, doch er war ein guter Freund und ich vertraute ihm. Außerdem hatte ich bereits seit einiger Zeit Pläne gehabt in die Stadt zu ziehen, um neu zu heiraten. Also bepackten wir unseren Karren, mieteten ein Pferd und verließen das Dorf. Wenn Sie wollen, so kann ich für Sie die Adresse von Hermann heraussuchen […]
Prof. Dr. Jürgen Kowalczyk (64), Symbolfoscher
Es ist wahr, dass man mir einige Stücke von der Halskette des Holzfällers Hektor gab, unter der Bedingung, dass ich sie ihm zurückgab. Zumindest gab man es mir mit Handzeichen so zu verstehen, da er ja nicht spricht. Er schien eine emotionale Verbindung zu dem Schmuckstück zu besitzen und deswegen war die Dorfgemeinschaft anscheinend überrascht, als er sich auf Anfrage mit einem Nicken bereit erklärte die Symbole untersuchen zu lassen.
Leider kann ich nicht viel berichten. Selbst nachdem ich mehrere Kollegen zu anderen Bereichen wie die Ägyptologie, der sumerischen Schrift und diversen europäischen Runen aufgesucht habe, konnten sie die Symbole der Kette keiner bekannten Kultur einordnen. Wenn ich raten müsste, dann sind es Schutzzeichen einer modernen, neoheidnischen Sekte. Doch gleichzeitig wirkten die Kettenstücke sehr alt.
Es ist wirklich bedauerlich, dass der Junge nicht berichten konnte oder wollte, von wo er damals hergekommen war […]
Feldwebel Henrich von Klucke (23), 36. Infanterieregiment
Da ich mir am Vorabend durch einen Unfall bei der Kutsche den Arm gebrochen hatte, war ich der einzige Soldat, der nicht an der Expedition nach Grünwick teilnahm und somit wohl auch der Einzige, der noch sprechen kann. Zwei Kompanien, insgesamt 90 Mann, zogen die Straße hinauf zum Dorf. Die meisten gingen davon aus, dass sich eine Katastrophe ereignet hatte und dachten wohl daran, Rettungseinsätze durchzuführen. Doch was immer sie dort gesehen haben, es war sicher kein Erdrutsch oder Feuer. Zwei Tage hörten ich nichts von meinen Kameraden, obwohl stündlich ein Bote einreiten sollte. Wie Sie bereits wissen, ist das Dorf zwar recht abgelegen im Wald, aber gleichzeitig auch nicht vollständig vom Rest der Welt abgeschnitten. Die schmale Straße war für die Jahreszeit gut gepflegt und sollte kein Hindernis für einen Reiter darstellen.
Gerade als wir vom Schlimmsten ausgingen und nach Verstärkungen fragten, kamen die Kameraden dann zurück. Bleich wie Kreide, aber augenscheinlich alle gesund und vollzählig. Ihre Uniformen saßen richtig und sie hatten auch kein Material verloren.
Dennoch lag in ihrem Blick etwas, was ich selbst bei ausgezehrten Veteranen des Krieges gegen Frankreich nicht gesehen habe.
Keiner von ihnen redete ein Wort. Auch unter intensiver Befragung kam kein Laut über ihre Lippen. Deswegen gibt es keine vollständigen Berichte über die Operation bei Grünwick.
Nach und nach wurden alle Männer der Einheit für nicht mehr diensttauglich erklärt, da sie kaum mehr auf Befehle reagierten. Die meisten müssen inzwischen von ihren Familien gepflegt werden oder stehen unter Obhut von Ärzten, die zwar ihre körperliche Unversehrtheit beteuern, aber anscheinend ist ihr Geist zerrüttet.
Ich will mich hier zwar nicht als Feigling präsentieren, aber ich kann nicht umhin dankbar für den Unfall an jenem Abend zu sein. Ich kann frohen Mutes gegen Franzosen oder Russen kämpfen, doch ich fürchte in Grünwick ist momentan etwas wogegen mein Bajonett nichts auszurichten vermag. Ich rate daher vorerst von weiteren Expeditionen ab […]
Sophia Mauerlauf (9), Schulkind
Ich war einmal in Grünwick um Andreas zu besuchen. Er war ganz freudig als wir uns sahen und lachte die ganze Zeit. Ich mochte nicht wie er lachte. War gruselig. Er zog mich in den Wald, um zu spielen. Dort trafen wir Hektor. Er war ein großer Mann, der die ganze Zeit Holz hackte. Seine Axt machte wisch wusch, ohne langsamer zu werden. Fast alle Dorfkinder waren bei ihm auf einer Wiese. Obwohl es Sommer war, waren überall Frühlingsblumen. Es war sehr hübsch. Wir spielten sehr lange Fangen, dann Verstecken und dann mit dem Ball! Und die ganze Zeit hackte Hektor Holz. Ein Baum nach dem anderen fiel um. Wir spielten den ganzen Tag lang! Irgendwann war ich sehr müde und fragte Andreas, ob wir zurückgehen konnten. Lachend nahm er mich an der Hand und führte mich zum Dorf. Der Weg zurück war länger als der hin zur Wiese, obwohl es der gleiche Waldpfad war! Als wir Grünwick erreichten, aß meine Mutter noch immer Kuchen mit Tante Getrud. Sie sah mich komisch an und frage, wieso ich so früh wieder zurück sei. Sie sagten mir ich war nur eine halbe Stunde weg. Sie zeigten mir auch ihre Uhren, doch die mussten alle kaputt sein! Denn ich war sicher den ganzen Tag lang mit Andreas beim Holzfäller Hektor spielen!
Hermann Ilckgrund (49), ehemaliger Jägermeister
Ich weiß nicht aus welchem finsteren Loch dieser Hektor gekrochen kam, doch seitdem er zur Holzfälleraxt griff, brachte er dem Dorf immer mehr Unheil. Ich bemerkte es mehr und mehr, da ich ja ständig im Wald unterwegs war! Ich erlegte immer weniger Tiere! Nein, es waren nicht an sich weniger Rehe oder Wildschweine im Gehölz. Ganz im Gegenteil! Ich entdeckte Spuren von riesigen Rotten und Herden und sah auch genug Wild. Nur gingen mehr Schüsse häufiger als sonst daneben und auch in meine Fallen trat nie etwas. Nein, mein Augenlicht wurde nicht schlechter! Ich war deswegen sogar bei einem Optiker in München! Auch war der Wald nicht mehr der Wald, den ich kannte. Wie ich das meine? Es ist schwierig zu erklären. Sehr schwierig. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es die richtigen Wörter dafür gibt. Je länger Hektor im Wald arbeitete, desto mehr veränderte sich das Gehölz.
Da waren eines Tages plötzlich Pfade, die ich nie zuvor gesehen habe, obwohl ich seit 20 Jahren durch die Wälder um Grünwick streife. Bäume, die ich nicht erkannte. Trockener Boden, wo Teiche sein sollten. Ich brauchte länger und länger, um meine Unterstände oder Jagdstühle zu erreichen. Auch glaubte ich, dass die Kiefern immer höher und höher in den Himmel ragten. Gleichzeitig kann ich nicht sagen, dass die Umgebung mir fremd vorkam. Da war noch immer etwas sehr Vertrautes in dem Wald, obwohl ich langsam, aber sicher, alle Orientierung verlor. In mir spürte ich immer noch, dass es der Ort war, den ich seit meiner Kindheit kenne. Nur schien dieser Ort mich nun abzustoßen. Wie ich sagte, es ist schwer zu erklären.
Irgendwann wurde das Unterholz immer dichter und die Bäume schienen näher aneinander zu rücken. Schwerer und schwerer kam ich in den Wald. Ich war dabei nicht mal der einzige. Andere Dorfbewohner bemerkten das gleiche. Der Einzige, der nicht diese Probleme hatte, war Hektor und die Horde an Kindern, die ihm überallhin folgte. Ich hörte eigentlich immer das Schlagen seiner gottlosen Axt. Einmal konfrontierte ich ihn auf der Jagd und fragte ihn, wie der Wald so wuchern konnte, wenn er doch so viel Holz schlug. Er starrte mich nur blank an und machte sich dann weiter an die Arbeit.
Dies war das letzte Mal, dass ich in dem Wald war. Ich fand auf dem Rückweg den Weg zum Dorf nicht mehr. Obwohl ich den Pfad zu kennen glaubte führte er nicht mehr hinaus aus dem Gehölz. Ich kann nicht wirklich das Entsetzen beschreiben, während ich stundenlang umherirrte. Es ist, als ob plötzlich die Haustür im eignen Heim fehlt und man nicht mehr hinauskann.
Irgendwann hackte ich mich dann durchs Unterholz und landete Gott sei Dank im Zwiebelacker des Schmiedes. Der Kerl aß da gerade zu Mittag und fragte mich verwundert, wieso ich so früh wieder da bin. Was für mich fast ein ganzer Tag war, war für ihn nur eine halbe Stunde gewesen. Laut aller Uhren im Dorf war es nicht mal Mittagszeit!
Da beschloss ich das Dorf zu verlassen… für immer. Ich versuchte andere zu überzeugen, aber die meisten Bewohner waren alteingesessene Genossen, die sich ein Leben außerhalb von Grünwick nicht vorstellen konnten. Auch sie fürchteten natürlich Hektor und auch sie wussten von den Geschehnissen im Wald, doch durch Gebete oder schiere Dummheit hofften sie darauf, dass sich alles von alleine klären würde. Am Ende konnte ich nur meinen alten Freund, den Herrn Gschwend, überzeugen mit mir zu gehen. Ich überlegte kurz, ob ich Hektor ins Gesicht schießen sollte, bevor ich aufbrach. Doch ich fürchtete, was ich erblicken würde, wenn ich ihm die Haut von der Nase schoss. Er ist kein Mensch, oh nein, das ist er nicht […]
Bericht von der Aufklärungsmission des 5. Kavallerieregiment vom 14.08.1888.
Wie befohlen wollten wir die Straße nach Grünwick auskundschaften, ohne in das eigentliche Dorf einzudringen. Sieben Kilometer vorm Dorf wurden wir aber gestoppt, da die Straße vollkommen überwachsen war. Junge Bäume blockierten den weiteren Weg und standen so dicht, dass sie regelrecht eine Mauer bildeten. Auch das Unterholz am Wegesrand wirkte unpassierbar, selbst für unsere Pferde. Wir fanden keine Spuren von den 200 Seelen des Dorfes. Einer meiner Männer glaubte allerdings das Schlagen einer Holzfälleraxt aus der Ferne zu hören […]
Anhand dieses finalen Berichts und der Zeugenaussagen beschloss die Kommission Grünwick und das umliegende Gebiet für unbestimmte Zeit zur Sperrzone zu erklären.
Am 16.April 1916, beinahe dreißig Jahre später, stieß eine Gruppe Infanteristen, die in der Region eine Übung durchführte, spontan in das Gebiet vor. Die Straße war dabei zwar mit Unkraut bewachsen, aber passierbar. Doch es fanden sich davon ab keinerlei Anzeichen menschlicher Besiedlung. Laut einer Befragung schien es, als ob es dort niemals ein Dorf gegeben hätte. Doch wegen der Kriegssituation wurde diese Meldung kaum beachtet und auch keine weitere Untersuchung durchgeführt. Bis heute ist der Ort nicht mehr als ein Flecken Wildnis.